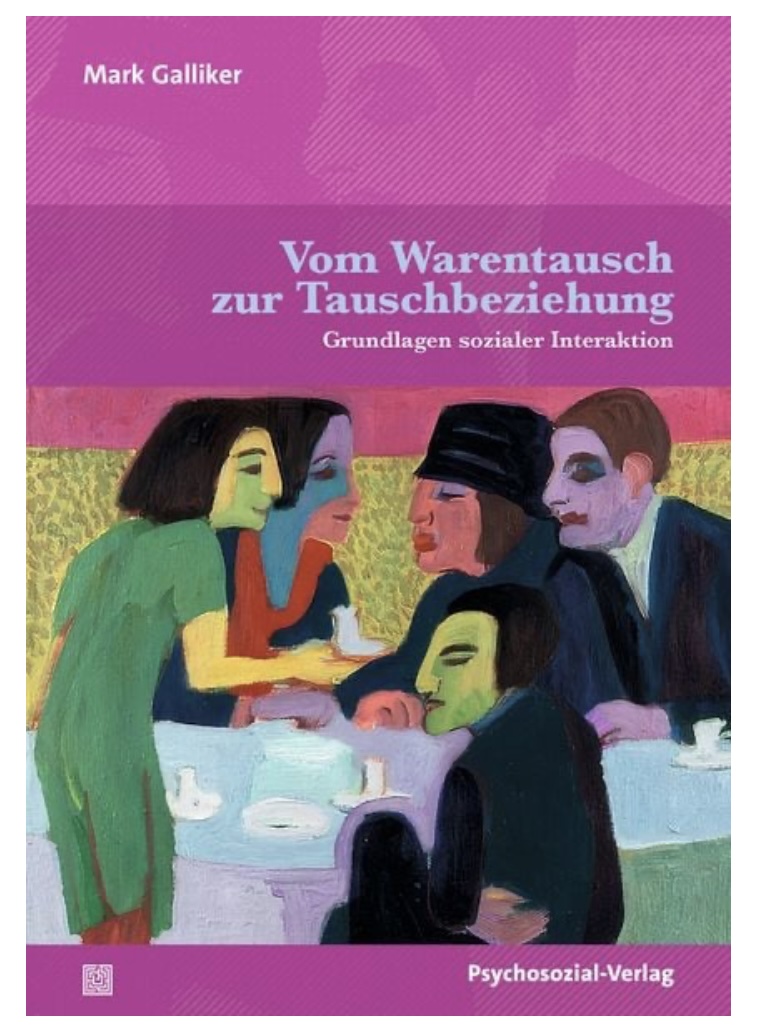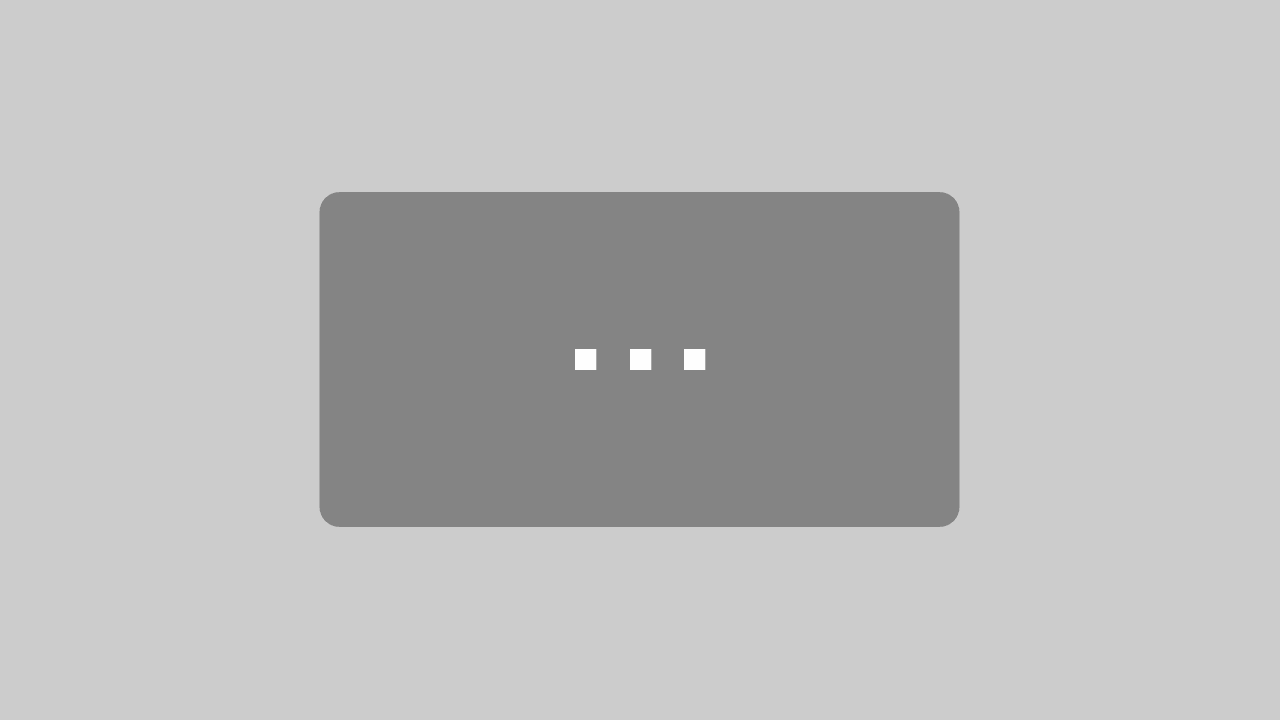Wann ist Kommunikation werthaltig?
Es ist eine interessante These, dass die Kommunikation zwischen Menschen durch den Austausch von Waren in ihrer Qualität beeinflusst wird. Si gibt es die These, dass das abstrakte Denken durch den Vergleich der Werte der Güter in Tauschbeziehungen. entstanden ist. Eine Vogelperspektive oder wie man heute sagen würde eine Metaposition war notwendig geworden. Man nimmt zusätzlich an, dass diese Entwicklung gerade durch die Sesshaftigkeit der Menschen, deren Beginn man vor etwa 11.000 Jahren datiert, begann. Und damals gab es noch kein Geld, das als Zwischenstufe beim Warenaustausch nützen konnte.
Wie hängen Kommunikation und Warenaustausch zusammen? Nicht ohne Grund heißt eine der wichtigsten humanistischen Psychologieansätze Transaktionsanalyse. Aber was wird transagiert? Es ist ja keine Waren im eigentlichen Sinne. Und die Schallwellen, die verbale Kommunikation macht, scheinen es auch nicht zu sein. Transagiert wird ein Angebot an den anderen, die einzelne Kommunikationseinheit zu einer Beziehung auszubauen. Daher ist eine ungeheuer wichtige Frage, wie Kommunikation und Austausch zustande kommen. Wann passt Kommunikation? Wann liegt sozusagen Wertigkeit der Beiträge vor?
Mark Galliker, ein Schweizer Professor für Psychotherapie hat sich diesem Thema sehr grundlegend genähert. Ich fühlte mich von Anfang an sehr angesprochen, weil er entsprechend meines wissenschaftlichen Werdegangs zunächst die Mathematik beleuchtet und dann über die Ökonomie zur Psychologie kommt.
„Vom Warentausch zur Tauschbeziehung“ titelt sein Buch. Das Buch hat sich außerdem zum. Ziel gesetzt, den Ursprung des abstrakten Denkens herauszufinden. Hier wird schon zu Beginn eine Verbindung zu ökonomischen Konstellationen angedeutet.
Ein Austausch bedeutet, dass es um verschiedene Güter geht. Dasselbe auszutauschen – der Autor bringt das Beispiel, wo sich zwei Personen zum gleichen Zeitpunkt jeweils 20 Reichsmark haben zukommen lassen, sei kein Austausch. Hier kann man spitzfindig hinterfragen, ob ein gegenseitiges den gleichen Geldwert Geben durch die sehr unterschiedlichen Motivation dabei nicht doch ein interessanter Austausch ist. Beispielsweise zahlt einer einem 20 Euro Schulden zurück und der andere gibt ihm danach 20 Euro, dass er seinem Kind ein Geburtstagsgeschenk kaufen kann. Denn im Abnehmen eines jeweiligen und dem anderen etwas Geben können schon deutlich unterschiedliche motivatonale Überlegungen vorliegen.
Die Hauptthese Gallikers ist: Das abstrakte Denken sei durch den Warentausch und die Abstraktion, die dazu nötig ist, entstanden. Nach Auffassung von Mark Galliker ist die Grundlage des abstrakten Denken von Menschen die ökonomische Transaktionen des Warentauschs. Es sei für die wertmäßige Vergleichbarkeit unterschiedlicher Güter erforderlich, ein Messkriterium zu entwickeln, das auf einer abstrakteren Ebene stattfindet.
Dieser quasi marxistische Ansatz, dass der Überbau, also die Denkmodelle und -prozeduren der Menschen aus den Produktionsverhältnissen stammen, ist nicht unüblich. Dieser Aspekt spielt zwar nicht die zentrale Rolle in seiner Argumentation, bleibt aber, weil es doch häufiger erwähnt wird, gerade aus meine Sicht als Volkswirt und Psychologe, etwas störend.
Dennoch geht er in seiner Argumentation sehr präzise und kleinteilig vor, so dass die Argumentation sehr klar wird. Verstehen zeigt sich im Antworten. Galliker zitiert hier Bodenheimer (1992), der Verstehen als Zurückgeben in der Sprache der Anrede und des Anredenden sieht. Es ist kein Deuten dabei. Ein interessantes Beispiel beschreibt der Autor aus einem kleinen Cafe, in dem die Kellnerin auf die Bestellung eines Wassers mit der Frage antwortet „Mit Glas oder ohne Glas? Und der daraufhin sagt „ist doch egal“. Unbestimmtheit führt zum Chaos.
Insgesamt gilt: Seine Qualifizierung der Marktwirtschaft oder des Kapitalismus als einer durchweg monopolistisch geprägten Struktur ist allerdings etwas einseitig, da es durchaus kompetitive Märkte mit einigermaßen vollkommener Marktstruktur und insbesondere hochkompetitive Märkte mit wenigen Anbietern, also Oligopole gibt. Gerade Nichtöknomen haben zuweilen eine eingeschränkte Vorstellung von Kapitalismus.
Was der Autor auch nicht im Blick hat, Ist die Rollenebene. Je nach Kontext und System, in dem etwas passiert, sind Aussagen und Antworten sehr unterschiedlich einzuschätzen. Wenn ein Verkäufer dem Kunden beim Verlassen des Ladens nicht „einen schönen Tag“ wünscht und der Kunde ihm daraufhin das Gleiche antwortet, kann man hier unterschiedliche Rollenadressierungen annehmen.
Aber insgesamt bleibt Gallikers Analyse ein bemerkenswertes Werk. Jeder Satz hat Gehalt. Vieles überzeugt, anders reizt zum Nachdenken. Es bleibt ein klasse Beitrag für Leute, die noch dranbleiben können.
Mehr zu interessanten Themen aus Psychologie und Wirtschaft:
https://www.youtube.com/@GuentherMohr/videos